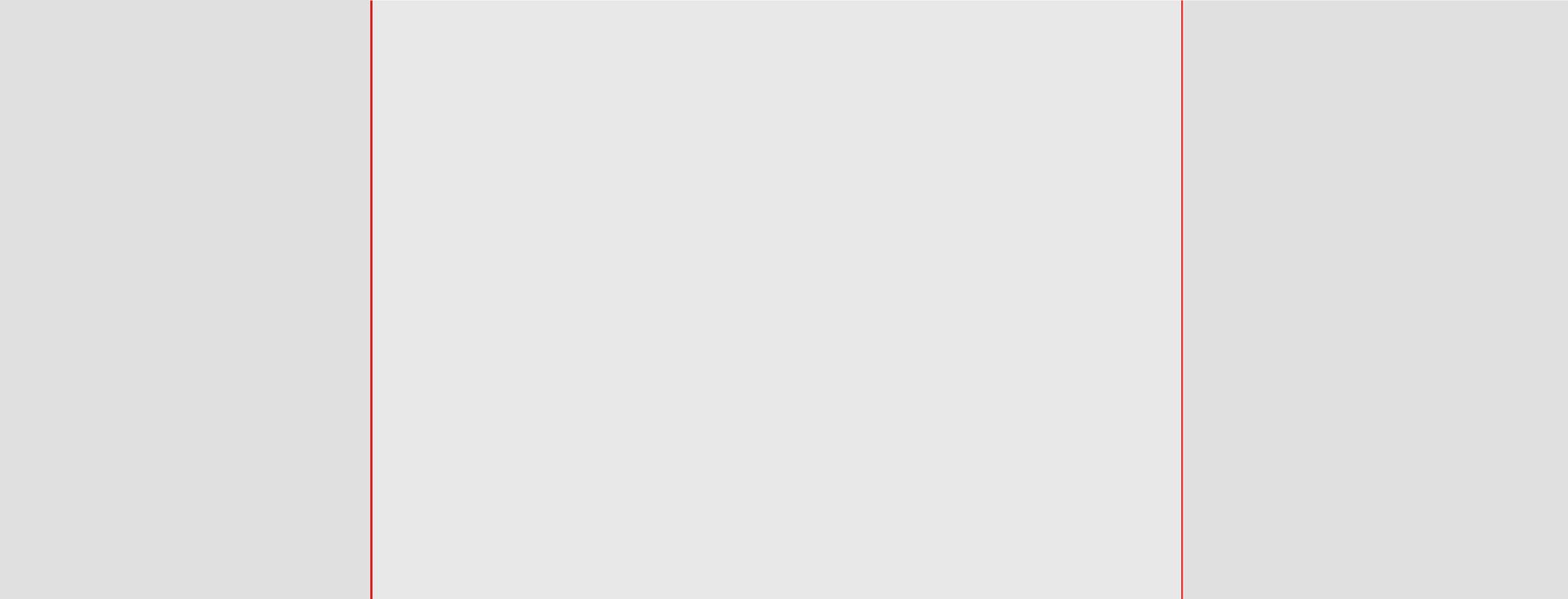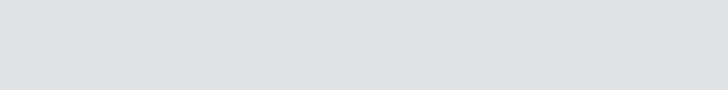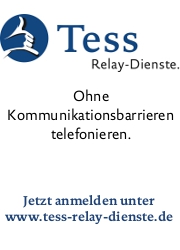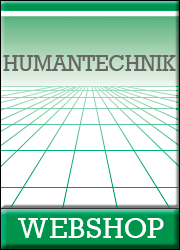Inklusion und Barrierefreiheit
Experten-Interview Juli 2025
 „Die erste Stunde
gehört dem Patienten“ - tauber Audiotherapeut gibt Einblicke in seine Arbeit
„Die erste Stunde
gehört dem Patienten“ - tauber Audiotherapeut gibt Einblicke in seine Arbeit
Oliver Hupka ist seit dem 01.01.2024 Therapeutischer Leiter im Helios Klinikum München West. Er ist mit Anfang 30 ertaubt, trägt heute zwei CI-s und beherrscht die Gebärdensprache. Über seine Arbeit als Audiotherapeut habe ich ihn interviewt.
Herr Hupka, was hat Sie dazu bewegt, Audiotherapeut zu werden?
Oliver Hupka: Meinen ersten Kontakt zu einer Audiotherapeutin hatte ich 2012 im Rahmen einer stationären Reha. Sie hat mich in meiner Entscheidungsfindung zur CI-Versorgung begleitet und gestärkt. Ich sah umgehend die Bedeutung der Audiotherapie und mein Wunsch war geboren, selbst in diesem Bereich zu arbeiten.
Welche Ausbildung oder Weiterbildungen haben Sie in diesem Bereich absolviert?
Ich habe Betriebswirtschaft studiert und später in einer Werbeagentur gearbeitet. Meine eigene Hörschädigung habe ich zwar als Einschränkung erlebt, aber mich nicht aktiv damit auseinandergesetzt.
In der einjährigen Weiterbildung mit abschließender theoretischer und praktischer Prüfung, sowie Facharbeit zum Audiotherapeuten (DSB), habe ich mir nicht nur die Fach- und Methodenkompetenzen angeeignet, sondern auch sehr viel Selbsterfahrung gemacht.
Wo liegt der Unterschied zwischen Audiotherapie und Hörakustik?
Ein Akustiker hat seinen Schwerpunkt in der Regel auf der technischen Ebene und apparativen Versorgung. In der Audiotherapie geht man bewusst davon weg, den Patienten auf diese zu reduzieren und den Erfolg am Sprachverstehen festzumachen. Es geht viel mehr darum, einen besseren Umgang mit der Schwerhörigkeit im Alltag zu finden.
Wie gestalten Sie den Erstkontakt mit einem neuen Patienten? Wie bauen Sie Vertrauen zu Ihren Patienten auf?
„Die erste Stunde gehört dem Patienten.“ Diesen Leitsatz aus der Audiotherapie versuche ich zu leben. Es geht darum in Erfahrung zu bringen, was den Patienten zu mir führt, welche Erwartungen er hat und was seine Ziele sind. Ich versuche den Patienten dort abzuholen, wo er sich gerade befindet und individuell auf seine Bedürfnisse einzugehen.
Welche therapeutischen Ansätze wenden Sie in Ihrer Arbeit an? Wie lange werden die Patienten bei Ihnen therapiert?
In der Audiotherapie findet man sehr viele verhaltenstherapeutische Ansätze. So üben wir z.B.
- wie der Patient bei einer Konfrontation mit angstauslösenden Reizen, Ängste abbauen kann
- wie er akustisch anspruchsvolle Situationen aufsuchen soll, anstatt diese zu meiden
- im Rahmen des sozialen Kompetenztrainings üben wir durch Rollenspielen, wie der Betroffene seine Gesprächspartner über die eigene Hörschädigung aufklären sollte
Die Konzentration gilt der Gegenwart und nicht der Vergangenheit. Die Hörbiografie ist zwar bedeutend für die Indikationsstellung und mögliche Prognosen, aber nicht beeinflussbar. Die Zukunft hingegen schon. Meist analysiert man in Gesprächen das Alltagserleben und leitet daraus Strategien ab, wie man es zukünftig anders machen könnte. Diese Veränderungsmotivation beim Patienten zu erreichen, ist von zentraler Bedeutung.
In meiner aktuellen Position begleite ich die Patienten von der präoperativen Phase bis hin zur lebenslangen Nachsorge. Insofern über Jahre hinweg.
Im Therapieprozess ist wichtig, dass auch die Angehörigen eingebunden werden. Wie geht das bei Ihnen?
In meinem Büro steht tatsächlich eine Couch, wobei ich immer betone, dass ich kein Psychologe oder gar Psychotherapeut bin. Auf der Couch sitzen häufig Angehörige.
Für mich ist das wunderschön zu sehen und traurig zugleich. Der Hörgeschädigte ist nicht isoliert, sein Umfeld mitbetroffen. Das geht so weit, dass man heutzutage Angehörigen ebenfalls ein Krankheitsbild attestiert. Umso wichtiger, dass die Angehörigen wesentlicher Bestandteil der Therapie sind.
Die Begleitung zeigt leider aber auch den Verlust der Selbstständigkeit. Nicht selten Stelle ich eine Frage und der Angehörige möchte antworten. Angehörige sind bei mir immer willkommen, sofern der Patient damit einverstanden ist. Tatsächlich möchte ich die Patienten aber dazu befähigen, perspektivisch „alleine“ zurecht zu kommen.
Welche Rolle spielt die Hörgeräteversorgung in Ihrer Therapie?
Studien besagen, dass etwa 60% aller CI-Träger bimodal (=die Versorgung beider Ohren mit unterschiedlichen Hörsystemen) versorgt sind. Man kann die Hörgeräte Versorgung überhaupt nicht ausklammern. In der Therapie spielt es für mich aber tatsächlich gar keine so große Rolle, da es ja wie oben bereits erwähnt, viel mehr um den Umgang mit der Schwerhörigkeit geht. Weder Hörgerät noch CI führen zu einer Normalhörigkeit, Einschränkungen bleiben immer bestehen.
Mit welchen Erwartungen kommen die Patienten zu Ihnen in die Klinik?
Sie wollen hören! Besser, wieder oder überhaupt! Und damit sind sie auch absolut richtig bei uns, aber in der Regel haben sie keine Vorstellung davon, was an diesem Wunsch alles hängt und wie viel Eigeninitiative dazu notwendig ist.
Wie motivieren Sie Patienten zur langfristigen Mitarbeit?
Ich erkläre unermüdlich die Bedeutung des binauralen Hörens (=Hören mit zwei Ohren) und allem was daran hängt. Und wie viel leichter sie es sich im Alltag machen könnten, wenn sie bestimmte Dinge ändern.
Was war Ihr bisher herausforderndster Fall – und wie haben Sie ihn gelöst?
Die herausforderndsten Fälle habe ich leider noch nicht gelöst. Es gibt natürlich auch Grenzen in der Audiotherapie, gerade dann, wenn tiefgreifende psychische Erkrankungen im Vordergrund stehen. Und leider ist es auch so, dass psychische (Begleit) Erkrankungen unter Hörgeschädigten keine Seltenheit darstellen.
Was sind die neuesten Entwicklungen in der Audiotherapie?
Als Audiotherapeut wird es ihnen nie langweilig, sie müssen mit dem technologischen Fortschritt der Hörsysteme mithalten und sich ständig fortbilden. Zu Beginn meiner Tätigkeit musste ich nicht jedes Smartphone kennen, heute ist es unerlässlich. Die Beratung zu Technik und Zubehör gehört ja ebenfalls zur Audiotherapie.
Sie haben den Vorteil, dass Sie Ihre Patienten auch in Gebärdensprache beraten können. Wie kamen Sie zur Gebärdensprache?
Durch den Gehörlosensport, in dem ich viele Jahre aktiv war und durch mein Ehrenamt bei der Deutschen Cochlea Implantat Gesellschaft. Seit 2014 bin ich Vizepräsident und Gründer der Jungen Selbsthilfe Deaf-Ohr-Alive. Hier kommunizieren wir zwar primär lautsprachlich, unterstützen aber auch durch LBG und wecken damit auch bei Menschen, die noch nie mit der Gebärdensprache in Berührung kamen, das Interesse an dieser wunderbaren Kommunikationsform.
Vielen Dank für das Interview!
Text: Judit Nothdurft
Bild: Oliver Hupka